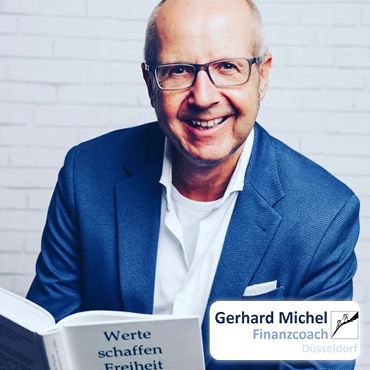Der Gewinn liegt im Einkauf
Immer wenn ich an diese klassische Redewendung aus der Realwirtschaft denke, kommt mir unweigerlich ein Obst- und Gemüsehändler in den Sinn. Er weiß, dass er mit den Kaufpreisen, die er am Großmarkt für seine Waren zahlt, seinen eigenen Gewinn festschreibt. Daher ist es für ihn absolut entscheidend, nicht zu viel für seine Auslage zu bezahlen. Sollte er überhöhte Preise akzeptieren, wäre es für ihn anschließend unmöglich, diese einfach an seine Kunden weiterzugeben – die harte Wettbewerbssituation im Einzelhandel lässt dies nicht zu. Die Kunden würden abwandern, und am Ende könnte er sein Geschäft aufgeben müssen.
Viele Aktionärinnen und Aktionäre neigen dazu, diese alte Kaufmannsweisheit zu ignorieren. Doch sie gilt in gleichem Maße für die Börsenwelt: Der erzielte Kaufpreis verankert die Rendite auf das eingesetzte Kapital. Wer diese Tatsache missachtet, wird zum Spekulanten. Das ist nicht verwerflich, bedeutet jedoch eine Abhängigkeit vom Glück. Und weder ein Obst- und Gemüsehändler noch ein Aktionär sollte sein Geschäft auf Glück aufbauen.
Die Berechnung der jährlichen Rendite auf das eingesetzte Kapital ermöglicht es Aktionären, fundierte Entscheidungen zu treffen – beim Kauf einer Aktie, während der Haltephase und beim Verkauf der Beteiligung. Wer seine jährliche Rendite auf Einzelwerte oder sogar auf das Gesamtportfolio kennt, kann Börsencrashs gelassener überstehen und genau dann kaufen, wenn andere in Panik geraten, weil ihnen eine zahlenbasierte Grundlage fehlt.
Die Argumente der quantitativ haltlosen Spekulanten – etwa „Meine Rendite auf das eingesetzte Kapital kenne ich nicht, aber die Aktie steigt doch langfristig immer weiter“ – haben bei wirtschaftlichem Gegenwind dieselbe Haltbarkeit wie Salat, den der Gemüsehändler in die Sonne stellt. Selbst der Kauf der edelsten Trüffel zu einem überhöhten Preis wird den Händler in den Bankrott treiben. Und so gilt leider auch für Aktionärinnen und Aktionäre: Es nützt nichts, etwas Hervorragendes zu einem überhöhten Preis zu kaufen.